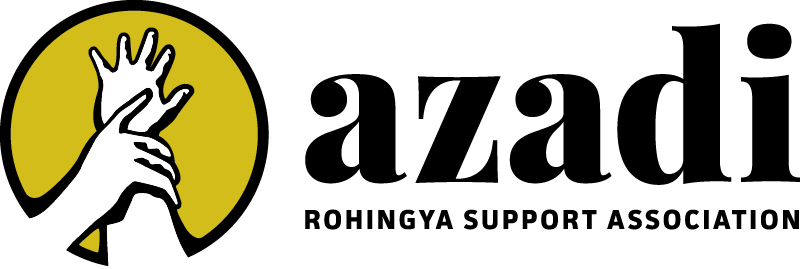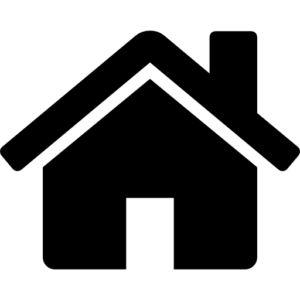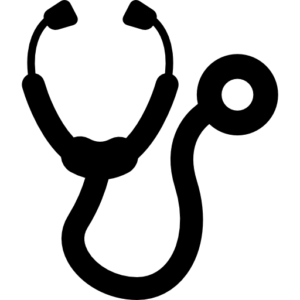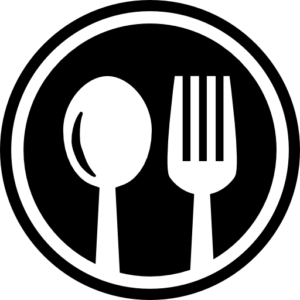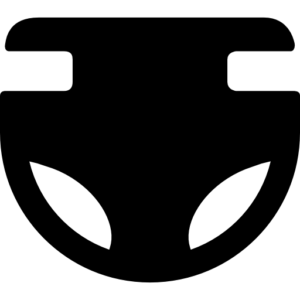Mit dieser Spendenaktion versucht Azadi 5000 Schweizer Franken für Nothilfe in Malaysia zu sammeln.
Die Rohingya in Malaysia verlieren zur Zeit ihre letzten Perspektiven. Umgeben von Fremdenhass stehen viele Menschen nach dem Ausbruch von COVID-19 ohne Job und Zuhause da. Viele wurden willkürlich verhaftet und in Gefangenenlager abgeschoben. Einschüchterung, Angst und Perspektivenlosigkeit prägen den gegenwärtigen Alltag der Rohingya.
Anfangs März gab es in Malaysia die ersten Fälle von Covid-19. Für die Rohingya sollte das erhebliche Folgen haben. Innerhalb von nur vier Monaten hat sich das Zusammenleben zwischen MalaysierInnen und Rohingya radikal verschlechtert. Eine weitere Krise befällt die vulnerable Gemeinschaft der Rohingya, mit kaum Aussichten auf Besserung.
Durch eine Spendenaktion versucht Azadi Geld zu sammeln um die Situation einiger, besonders bedürftiger Rohingya in Malaysia zu verbessern und sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.
Ende Juni konnten wir mit Hilfe von unseren UnterstützerInnen die Monatsmiete von 33 Familien in Kuala Lumpur übernehmen. Mit dieser Spendenaktion möchten wir dort anknüpfen und uns mit einem Fokus auf besonders bedürftige Frauen und ihren Kindern weiter im Bereich der Nothilfe engagieren.
Die Rohingyas in Malaysia haben es zur Zeit sehr schwer. Weiter unten erzählt Shenia, ein direktbetroffenes Rohingya-Mädchen, wie Sie den Alltag in Kuala Lumpur zur Zeit erlebt.
Wenn du erkennst,
dass dein Leben keinen Wert hat.
Shenia ist eine 15-jährige Rohingya Muslimin. Sie ist in Malaysia geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern sind vor 20 Jahren aus Myanmar geflüchtet. Bis vor kurzem ging Shenia an eine renommierte Flüchtlingsschule. Sie spricht vier Sprachen: Rohingya, Burmesisch, Malaysisch und Englisch und kommuniziert in einem Gemisch aus Englisch und Malaysisch. Eine gängige Ausdrucksweise unter Malaysierinnen, welche zwei- oder mehrsprachig aufwachsen.
WeiterlesenShenia wirkt «malaysisch» und fügt sich perfekt in die lokale Gesellschaft ein. «Für mich ist Malaysia mein Heimatland und bis vor kurzem fühlte ich mich sicher hier», sagt sie. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich alles verändert. Shenia’s Vater hat seinen Job verloren und auf die Strasse traut sie sich nicht mehr. Ihr jüngerer Bruder und ihre Mutter wurden kürzlich verhaftet und sassen zwei Wochen lang in Untersuchungshaft – seit Ausbruch des Coronavirus eine Routine so scheint’s. Anfangs März sind in Malaysia die ersten COVID-19 Fälle identifiziert worden. Die Regierung reagierte schnell und verhängte am 18. März den totalen Lockdown. Mit steigender Unsicherheit begann die Verbreitung von gezielter Diskriminierung gegen Flüchtlinge und insbesondere gegen Rohingya.
Ebenso rasch wurden in den sozialen Medien fremdenfeindliche Darstellungen und Anschuldigungen verbreitet, die die Rohingya als aktive Verbreiter des Virus darstellen. Auf die anfängliche Diskriminierung folgten schnell schwerwiegende politische Massnahmen. Bisher wurden die Rohingya auch ohne gültige Papiere in Malaysia geduldet. Mit ihren schlecht bezahlten Arbeiten leisteten sie einen entscheidenden Beitrag zum Wachstum der urbanen Zentren Malaysias. Seit dem Ausbruch des Coronavirus änderte sich dies aber plötzlich. Tausende von Rohingya wurden aufgrund fehlender Aufenthaltspapiere verhaftet und in Untersuchungsgefängnisse gebracht, wo Geflüchtete neuerdings mit Peitschenhieben versehen werden – unter dem Vorwand der Bekämpfung des Coronavirus.
Erreicht wird jedoch das Gegenteil: Neuinfektionen in den Gefängnissen stiegen schnell. Hilfsorganisationen erhalten immer mehr Meldungen von Menschen, die nicht genug zu essen haben – die meisten haben ihre Jobs verloren. Moscheen sind nicht mehr zugänglich für die Rohingya. Familien werden aus ihren Wohnungen vertrieben. Denn, das Vermieten von Wohnraum an ‘illegale Migrantinnen’ wird neu mit bis zu fünf Jahren Gefängnis und sechs Peitschenhieben bestraft. Schilder in den Strassen erinnern potenzielle Vermieterinnen an das Gesetz und dessen Ahndung.
Ende Juni 2020 verkündete der neue Premierminister Malaysias, Muhyiddin Yassin, das Land werde keine Rohingya-Flüchtlinge mehr aufnehmen. Bereits vor diesem offiziellen Statement wurden mehrere Flüchtlingsboote mit hunderten Rohingya-Flüchtlingen, abgewiesen und auf das offene Meer zurückgeschickt. Einer Studie zufolge hat sich in Malaysia die Akzeptanz gegenüber geflüchteten Menschen seit der Corona-Pandemie drastisch verringert. 82% der Befragten sind für eine Schliessung der Grenzen (ein Jahr zuvor waren es 43%) – der höchste Wert weltweit.
Innerhalb von nur vier Monaten hat sich das Zusammenleben zwischen Malaysierinnen und den Rohingya drastisch verschlechtert. Shenia erläutert: «Unser Leben ist voller Hass, Diskriminierung, Schikane und Rassismus. Gestern, wurde mein 6‑jähriger Bruder und ich auf der Strasse geschlagen und beschimpft «You, Rohingya are making problems in Malaysia.». Die Möglichkeiten für die Rohingya sind enorm begrenzt. Mit der weltweit sinkenden finanziellen Unterstützung des humanitären Sektors nehmen die Chancen auf eine Umsiedlung durch die UNO in einen Drittstaat drastisch ab. Auch eine Rückkehr in ihr Heimatland Myanmar, ehemaliges Burma, ist für die Rohingya keine Option – aufgrund der dort andauernden
Menschenrechtsverletzungen und der gezielten Verfolgung der Rohingya-Minderheit. Somit haben die meisten Rohingya letztendlich keine Wahl. Trotz ihrer prekären Lage bleiben Shenia und andere Rohingya hoffnungsvoll auf eine bessere Zukunft. «Am Ende eines jeden Tunnels gibt es Licht», ist Shenia überzeugt und dankt all denjenigen, welche in dieser schwierigen Zeit Solidarität zeigen und Unterstützung leisten.